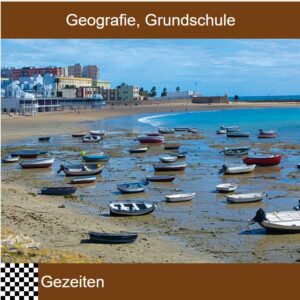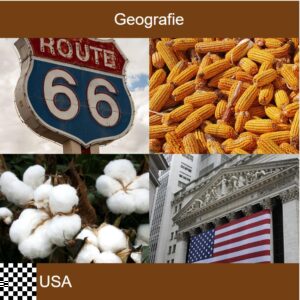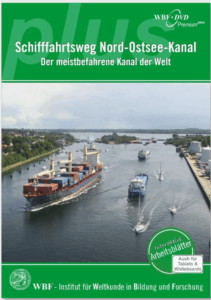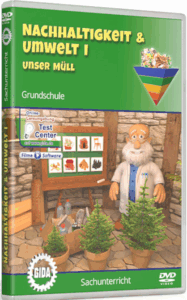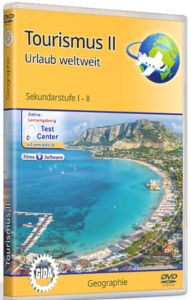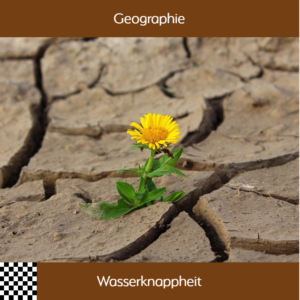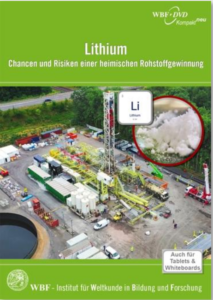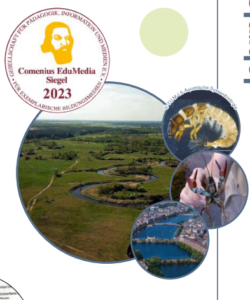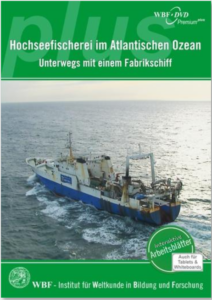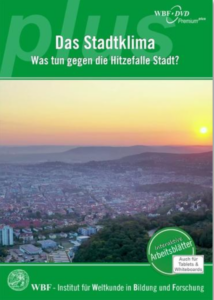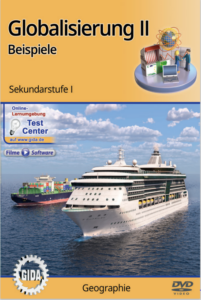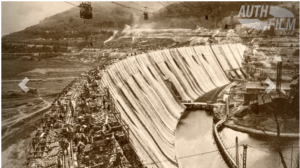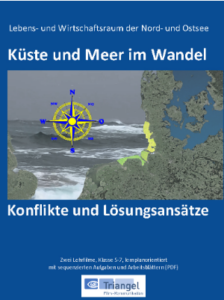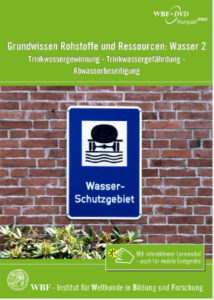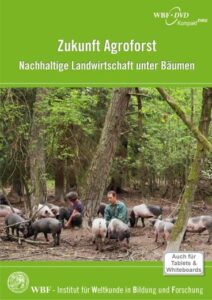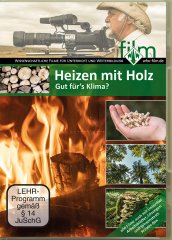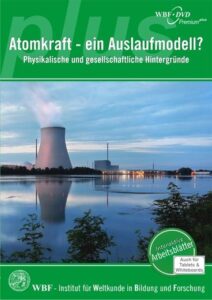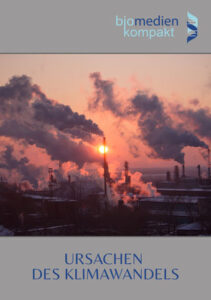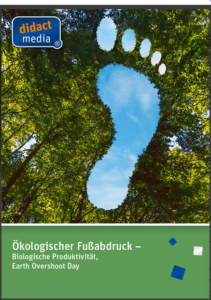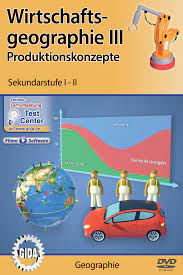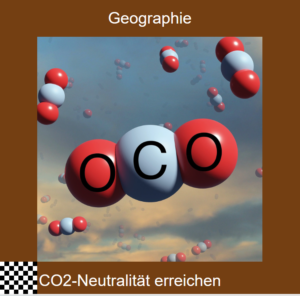Ländliche Räume in Deutschland
Trotz der zunehmenden Verstädterung spielen die Ländlichen Räume in Deutschland eine zentrale Rolle. Die Produktion stellt verschiedene Raumkonzepte vor und erklärt, über welche Merkmale und Geofaktoren die „Ländlichen Räume“ definiert werden können. Auch der Unterschied zu den „Städtischen Räumen“ wird erläutert und an einer Beispielregion konkretisiert.
Paludikulturen
Klimaschutz und Landwirtschaft in Mooren
Moore sind wichtige Lebensräume, Ökosysteme und weitgehend unterschätzte Klimaschützer, denn sie sind die effektivsten Kohlenstoffspeicher, die die Natur zu bieten hat. Die Produktion zeigt mit einem Moderator, was Paludikulturen eigentlich sind, wie der Schutz mit ihnen im Hoch- und Niedermoor gelingen und gleichzeitig wie effektiver Klimaschutz aussehen kann.
Hafen Rotterdam – Hafen der Superlative
Drehscheibe des globalisierten Welthandels
Am Beispiel des Hafens Rotterdam wird die komplexe Logistik von verschiedenen Gütern und Verkehrsmitteln deutlich. Als Zentrum für den Erdölhandel und weltweiten Containerumschlag hat dieser Hafen der Superlative eine enorme Bedeutung. Und auch im globalisierten Welthandel spielt der Hafen Rotterdam eine wichtige Rolle und ist damit Europas „Tor zur Welt“.
Geothermie in Island
Voraussetzungen, Nutzung, Nachhaltigkeit
Auf Island ist die Erde sehr aktiv, die Geothermie ist dort eine kostengünstige Energiequelle. Expertinnen und Experten erklären die Technik, Chancen und Risiken dieser Energieform. Anhand von Beispielen wird deutlich, wie Geothermie funktioniert und welche Auswirkungen sie auf Umwelt und Gesellschaft haben kann. Interviews und Animationen veranschaulichen das Thema.
Zusatzmaterial:
Arbeitsblätter mit Lösungen – Testaufgaben – Interaktive Aufgaben
Klimazonen der Erde
Die gemäßigten Breiten liegen geografisch zwischen den Tropen und Polarregionen. Das besondere Kennzeichen sind die ausgeprägten vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Misch- und Laubwälder, Wiesen und Ackerland bestimmen die typische Vegetation. Es gibt jedoch auch gemäßigtes Regenwald-, Steppen- und Gebirgsklima. Die gemäßigten Breiten bieten vielfältige Lebensräume für Fauna und Flora.
Zusatzmaterialien:
20 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung, – 20 Testaufgaben, – 10 Interaktive Aufgaben.
USA: Landschaften, Klima, Tierwelt
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sehr unterschiedliche Landschaften, darunter Sümpfe, Gebirge und Wüsten. Der Film stellt wichtige Gewässer und Nationalparks wie den Grand Canyon, Yellowstone und Yosemite vor. Außerdem werden Naturphänomene und die Folgen des Klimawandels behandelt.
Zusatzmaterialien:
20 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung – 20 Testaufgaben – 10 Interaktive Aufgaben
USA: Landwirtschaft, Industrie, Natur
Der Film zeigt die Vereinigten Staaten von Amerika als Land mit wirtschaftlicher Stärke, landwirtschaftlicher Vielfalt und technologischem Fortschritt. Anhand von Regionen wie dem Corn Belt und dem Sun Belt wird verdeutlicht, wie Geografie und Geschichte die Entwicklung des Landes beeinflusst haben. Ergänzend bietet der Film Einblicke in Industrie, Energieversorgung und Tourismus und zeichnet so ein umfassendes Bild der ökonomischen Strukturen der USA.
Zusatzmaterialien:
20 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung – 20 Testaufgaben – 10 Interaktive Aufgaben
Küstenformen in Deutschland
Lange Sandstrände oder steile Klippen – die Küsten an der Nord- und Ostsee haben viele Gesichter, denn sie werden ständig von Wind, Strömungen und Wellen umgeformt. Die Produktion zeigt die verschiedenen Entstehungsarten der Küstenformen von der Wattenküste bis zur Boddenküste. Und auch die Nutzung der Küsten durch Tiere und den Menschen werden erläutert.
Schifffahrtsweg Nord-Ostsee-Kanal
Der meist befahrene Kanal der Welt
Ein Kapitän, ein Lotse, ein Kanalsteurer, Festmacher und ein Fährführer werfen die Frage auf, wo sie arbeiten. Während der gesamten Durchfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal stehen sie und das Containerschiff Elbsailor im Mittelpunkt. Die wirtschaftliche Bedeutung der Wasserstraße wird besonders betont. Ausführlich werden die Anforderungen für die Schifffahrt dargestellt wie der Schleusenvorgang oder beim Gegenverkehr das Manövrieren an den Weichen. Fähren, Tunnel und Brücken ermöglichen die Kanalüberquerung. Für die reibungslose Passage von der Nordsee in die Ostsee und umgekehrt sorgen Lotsen und Kanalsteurer.
Nachhaltigkeit & Umwelt I
Unser Müll (mit Professor Lunatus)
Die Filme spannen einen Bogen von der Frage, was die Begriffe Umwelt und Nachhaltigkeit eigentlich bedeuten, was es mit dem Problem Müll auf sich hat, bis hin zu Tipps, wie eigenverantwortliches Handeln aussehen kann. Zunächst werden die Protagonisten vorgestellt: Ben und Sophia erkunden ihre Umwelt und erkennen, alles hängt mit allem zusammen. Professor Lunatus ist wie immer mit von der Partie und kann komplexere Zusammenhänge erklären. Enthalten sind die Filme: – Umwelt und Nachhaltigkeit (8:05 min) – Über Rohstoffe und Müllberge (8:25 min) – Müll trennen und recyceln (7:50 min) – Was kann ich selbst tun? (4:55 min)
Zusatzmaterial:
Grafiken [PDF] – Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF] – Online-Zugang zum GIDA-Testcenter
Klimazonen der Erde: Tropen
Die Tropen erstrecken sich zwischen dem Wendekreis des Krebses und des Steinbocks und zeichnen sich durch warm-feuchtes Klima sowie Landschaften wie Regenwälder und Savannen aus. Der Film erklärt anhand des Gradnetzes die Entstehung der Klimazonen und zeigt Fauna und Flora sowie deren Bedrohung durch den Menschen. Er thematisiert Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der Ökosysteme und regt zur Reflexion über den Klimawandel an.
Zusatzmaterial:
20 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung, – 20 Testaufgaben, – 10 Interaktive Aufgaben.
Tourismus II
Urlaub weltweit
Das Filmpaket behandelt das Thema Tourismus. Es wird die Entstehung des weltweiten Tourismus erläutert und die Gründe für die Beliebtheit des Reisens aufgezeigt. Der Mittelmeerraum wird dabei mit seinen besonders günstigen Voraussetzungen für den Tourismus dargestellt. Zudem wird die touristische Entwicklung der indonesischen Insel Bali behandelt, wobei veranschaulicht wird, wie innerhalb weniger Jahrzehnten aus einem Geheimtipp ein Ziel für den Massentourismus wurde. Abschließend werden die positiven und negativen Auswirkungen des aufkommenden Massentourismus in Nepal aufgezeigt. Die Inhalte werden durch 3D-Computeranimationen visualisiert. Folgende Filme sind Bestandteil des Pakets: – Entwicklung des weltweiten Tourismus (8:45 min) – Tourismus im Mittelmeerraum (10:40 min) – Der Tourismus verändert Bali (9:30 min) – Nepal – nachhaltiger Tourismus? (9:25 min).
Zusatzmaterial: 6 Grafiken [PDF] – 11 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF] – Begleitheft – Interaktive Testaufgaben
Wasserknappheit
Wasserknappheit ist ein globale Problem. Verschärft wird dieses Problem durch das starke Bevölkerungswachstum, den Klimawandel und ineffiziente Wassernutzung. Dürren und die Verringerung der Verfügbarkeit von Trinkwasser sind unter anderem die Folge. Aufgeklärt wird über die Ressource Wasser und deren Verfügbarkeit. Ein Fokus liegt hierbei auf dem virtuellen Wasserverbrauch. Des Weiteren werden die ökologischen und sozialen Herausforderungen gezeigt, die durch die Wasserknappheit entstehen. Gezeigt wird die Wassersituation weltweit und in Europa sowie in Spanien. Zusatzmaterial: Hinweise zur Unterrichtsplanung; Interaktive Arbeitsblätter [H5P]; Glossar.
El Niño und La Niña mit ihren globalen Auswirkungen
In regelmäßigen Abständen löst das Wetterphänomen El Niño im Südpazifik extreme klimatische Ereignisse zwischen Südostasien und der Westküste Südamerikas aus. Verschiedene Extremwettereignisse sind die Folge. Aber was verursacht dieses Phänomen und was hat La Niña damit zu tun? Diese Fragen und die globalen Auswirkungen werden in dieser Produktion erklärt.
Lernziele:
Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards Die Schülerinnen und Schüler . . . – kennen den Pazifik und seine Verortung auf der Erde; – können die Größe des Pazifiks zur gesamten Erdoberfläche in Relation setzen; – erkennen, dass die enorme Größe des Pazifiks dafür sorgt, dass er das Klima weltweit beeinflussen kann; – kennen die an den Pazifik angrenzen Staaten; – kennen die Fachbegriffe El Niño, La Niña und ENSO und können sie beschreiben; – kennen die Schwankungen der mittleren Wassertemperatur und deren zeitliche Abfolge; – beschreiben die Meeresströmungen im Pazifik, die durch die Passatwinde angetrieben werden; – können Diagramme auswerten, um die zeitliche Abfolge der Phänomene der ENSO darzustellen; – beschreiben die Auswirkungen der Schwankungen der klimatischen Bedingungen auf die angrenzenden Länder; – können den Passatkreislauf im Südpazifik erklären; – kennen die Folgen der Passatwinde für Meeresströmungen, Wassersspiegel und Wassertemperatur im äquatorialen Pazifik; – kennen die Folgen der klimatischen Bedingungen über dem Pazifik auf das Klima der angrenzenden Länder; – kennen die Ursachen für den Fischreichtum im östlichen Pazifik während der neutralen Phase; – erkennen, dass die Passatwinde einen Kreislauf von Meeresströmungen im äquatorialen Pazifik antreiben; – nutzen ihr Wissen über die Luft- und Meeresströmungen, um auf die klimatischen Verhältnisse in den an den Pazifik angrenzenden Regionen zu schließen; – erkennen, dass eine Meeresströmung kaltes, nährstoffreiches Wasser nahe an die Meeresoberfläche im östlichen Pazifik befördert; – erschließen sich die klimatischen Bedingungen an Land aus den Windverhältnissen und den Temperaturen im Pazifik.
Planetare Belastbarkeitsgrenzen
Die ökologischen Ressourcen auf der Erde sind beschränkt. Werden die planetaren Belastbarkeitsgrenzen in einzelnen Bereichen überschritten, besteht die Gefahr irreversibler Veränderungen in der Umwelt. Um Stressfaktoren zu verringern, müssen Maßnahmen eingeführt und verschiedene Methoden entwickelt werden, um die Tragfähigkeit der Erde zu erhalten.
Lernziele:
Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards Die Schülerinnen und Schüler . . . – erklären das Konzept der planetaren Belastbarkeitsgrenzen und deren Bedeutung für das Ökosystem Erde; – nennen die neun elementaren Belastbarkeitsgrenzen, die vom Stockholm Resilience Centre identifiziert wurden; – beschreiben grundsätzlich die Auswirkungen der Überschreitung der planetaren Belastbarkeitsgrenzen auf die Stabilität des Ökosystems und das zukünftige Leben auf der Erde; – erklären die Bedeutung der Biosphäre und ihrer biologischen Vielfalt für die Stabilität der Erde; – beschreiben den Zusammenhang zwischen genetischer Vielfalt und der Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen an Umweltveränderungen; – nennen Beispiele für Ökosystemleistungen und erläutern deren globale Bedeutung; – beurteilen die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Unversehrtheit der Biosphäre und die damit verbundenen Risiken für die Zukunft; – erklären die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels auf das globale Ökosystem; – beschreiben die Rolle von Aerosolen und Treibhausgasen in der Atmosphäre und deren Einfluss auf Klima und Gesundheit; – analysieren die Bedeutung des Verbots von FCKW für den Schutz der Ozonschicht; – definieren, was unter dem Begriff „Xenobiotika“ verstanden wird, und erklären die negativen Auswirkungen auf Ökosysteme und die Systeme der Erde; – erklären die Bedeutung der Ozeane als Kohlenstoffsenken und die Folgen der Ozeanversauerung für marine Lebewesen; – nennen Beispiele für die Auswirkungen des Klimawandels und menschlicher Aktivitäten auf die Süßwasservorräte der Erde; – beurteilen die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen; – beschreiben die Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft; – erklären die Bedeutung der biogeochemischen Stoffkreisläufe für die Ökosysteme und die Probleme, die durch Überdüngung mit Stickstoff und Phosphor entstehen; – beurteilen die Wichtigkeit einer nachhaltigen Landnutzung.
Der Golfstrom
Die bekannteste und für Europa wichtigste Meeresströmung ist der Golfstrom. Neben seiner Entstehung und den beteiligten Einflussfaktoren werden die Auswirkungen für Europa erklärt. Besonders auf den Zusammenhang mit Klima und Landwirtschaft wird eingegangen. Aber auch eine eventuelle Abschwächung oder ein möglicher Zusammenbruch werden thematisiert.
Lernziele:
Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards Die Schülerinnen und Schüler . . . – verstehen den Zusammenhang zwischen dem Golfstrom und den weltweiten Meeresströmungen; – kennen Wind als Antrieb für eine Meeresströmung; – verstehen die thermohaline Zirkulation; – kennen die Komponenten des Golfstromsystems sowie die möglichen Antriebe der Strömungen; – erläutern die Teilströmungen des Golfstromsystems; – analysieren die Wechselwirkungen des Golfstromsystems mit anderen Strömungen; – erklären die Mechanismen, die den Verlauf des Systems beeinflussen; – kennen maritimes und kontinentales Klima; – stellen die Auswirkungen der warmen Meeresströmung für Europas West- und Nordküste dar; – verstehen den Einfluss des Golfstromsystems auf das Verhalten der Fischschwärme und somit auf die Hochseefischerei; – nennen die Vorteile eisfreier Häfen in Nordeuropa; – entdecken die Auswirkungen des milden Klimas auf die Lage der Vegetationszonen und auf die Landwirtschaft; – beschreiben die Lage der Vegetationszonen in Europa und vergleichen mit dem amerikanischen Kontinent; – kennen die Folgen der Verlangsamung der thermohalinen Zirkulation für den Nordatlantikstrom; – interpretieren die Folgen eines deutlich schwächeren Nordatlantikstroms für das Klima auf dem europäischen Festland; – verorten die Bereiche im Atlantik, in denen durch mehr Schmelzwasser eine Verringerung der Dichte erfolgt.
Kairo – Ägyptens pulsierende Hauptstadt
Kairo ist mit über 20 Millionen Einwohnern das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Ägyptens und auch der arabischen Welt. Die Produktion stellt die facettenreichen Gesichter der Stadt vor, zeigt anhand der Überbevölkerung, des Stadtwachstums sowie der Armut die Probleme der Megacity auf und stellt geplante Lösungsmöglichkeiten vor.
Lernziele:
Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards Die Schülerinnen und Schüler . . . – beschreiben die Bedeutung Kairos für Ägypten; – verorten Kairo in Ägypten; – beschreiben das Klima Kairos; – benennen das Bevölkerungswachstum als eine prägende Entwicklung für Kairo; – werten Satellitenbilder – auch im Zeitraffer – aus; – benennen verschiedene Einflüsse auf die Stadtentwicklung Kairos; – nennen charakteristische Merkmale von „orientalischen Städten“; – beschreiben kartografische Darstellungen problemorientiert; – beschreiben Aspekte der Stadtentwicklung Kairos; – unterscheiden die Begriffe der formellen und informellen Siedlung; – definieren den Begriff und verorten Satellitenstädte um Kairo; – beschreiben Strategien der Wohnraumerschließung und beurteilen diese; – beurteilen Herausforderungen für die Megacity Kairo bei Müllentsorgung, Wasserversorgung und Verkehr; – beschreiben/diskutieren Lösungsansätze, auch aus der Sicht der lokalen Bevölkerung; – beschreiben und erörtern Megabauprojekte östlich von Kairo.
Lithium
Chancen und Risiken einer heimischen Rohstoffgewinnung
Ein unscheinbares weißes Pulver ist der Hoffnungsträger der Energiewende: Lithium. Ob Smartphone oder E-Auto, es steckt in fast jedem Akku. Animationen zeigen den rasant steigenden Bedarf – und unsere Abhängigkeit von Importen dieses kritischen Rohstoffs. Derzeit kommt er großenteils aus den Anden, wo in großen Becken, Sole aus Salzseen zur Gewinnung des „weißen Goldes“ verdunstet wird. Anwohner berichten, warum sie um ihre Existenz und um die des sensiblen Ökosystems bangen. Tief unter dem Oberrheingraben liegt auch ein Lithium-Schatz. Als Nebenprodukt von Geothermiekraftwerken könnten wir künftig einen Teil unseres Bedarfs lokal und klimaneutral decken. Oder überwiegt doch die Angst vor dem Erdbebenrisiko?
Zusatzmaterial:
Interaktives Lernmodul
Ökosystem Fluss unter dem Einfluss des Menschen
Unsere Flüsse sind bedroht – durch den Menschen. Das Medium beleuchtet das Ökosystem Fluss zunächst als natürlichen Lebensraum, dann aber auch unter dem Aspekt, wie der Mensch ihn nutzt, ihn verändert hat und welche Folgen für das Ökosystem selbst, die Natur und den Menschen hat. Die verschiedenen Aspekte werden filmisch aufgezeigt und mit Informationen und Aufgaben vertieft. Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF/Word]; H5P-Aufgaben [interaktiv]; Filmsequenzen.
Moore und ihre Bedeutung für den Klimaschutz
Moore sind Übergangszonen zwischen Wasser und Land. An die Moore angepasste Pflanzenarten wie Torfmoose werden vorgestellt und die Bedeutung der Moore für den Klimaschutz thematisiert. Die meisten Moorflächen in Deutschland sind entwässert und werden vor allem landwirtschaftlich genutzt. Doch während intakte, nasse Moore effektive Kohlenstoffspeicher sind, entweichen aus trockengelegten Mooren große Mengen an Kohlenstoffdioxid. Die Wiedervernässung von Mooren könnte ein Beitrag sein, um Deutschlands Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Zum Schluss wird die Paludikultur beschrieben, eine nachhaltige Form der Land- und Forstwirtschaft auf nassen Moorstandorten
Hochseefischerei im Atlantischen Ozean
Der Fischtrawler Joseph Roty 2 fischt mit dem Schleppnetz im Nordostatlantik den Blauen Wittling, eine Dorschart. Die internationale Crew, 50 Mann, ist Tag und Nacht im Einsatz, außer bei Orkan und schwerem Seegang. Unter Deck wird der gefangene Seefisch weiterverarbeitet zu Surimi, einem Krebsimitat. Verschiedene Crewmitglieder berichten aus ihrem Arbeitsleben. Von einer Überfischung oder einer Gefährdung des Ökosystems Meer wollen sie nichts wissen. Der Kapitän hat mit anderen Trawlern, die ihn bedrängen und am Fang hindern, zu tun. Modernere Trawler fangen Seefische, die als Fischmehl für Aquakulturen verwendet werden.
Das Stadtklima
In ihrer Berliner Dachwohnung wird einer Studentin das Lernen zur Qual. Wissenschaftler überfliegen mit einer Thermokamera die Stadt und machen sichtbar: Berlin liegt als Wärmeinsel im kühleren Umland. Es hat ein ausgeprägtes „Stadtklima“. Ältere und kranke Menschen in Städten leiden besonders unter den Folgen. Hitze gilt hier inzwischen als Naturkatastrophe. Animationen verdeutlichen, warum Beton, Glas und Asphalt den Strahlungs- und Wärmehaushalt verändern und wie andererseits Grünflächen und Frischluftbahnen die Stadt kühlen. Internationale Beispiele zeigen, mit begrünten Dächern, Fassaden, Innenhöfen, Verkehrs- und Parkflächen, die Stadt der Zukunft ist grün!
Globalisierung II
Die Grundlagen der Globalisierung werden in drei Filmen hinsichtlich ihrer räumlichen Auswirkungen, ihrer positiven und negativen Folgen und der bestehenden Herausforderungen konkretisiert. Dabei wird je ein Beispiel aus dem primären, sekundären und tertiären Sektor behandelt. Im ersten Film wird anhand des Imports von Blumen nach Deutschland gezeigt, wie der Handel über Grenzen hinweg mit einem Produkt des primären Sektors funktioniert. Der zweite Film beschäftigt sich mit dem Beispiel der Produktion von T-Shirts (sekundärer Sektor). Es wird gezeigt, wie sich die Produktionskette im Zeitalter der Globalisierung um die halbe Erde erstreckt. Und es werden Vor- und Nachteile der Globalisierung am Fallbeispiel behandelt. Der dritte Film zeigt, wie auch der tertiäre Sektor sich im Zeitalter der Globalisierung verändert. Am Beispiel des Kreuzfahrttourismus wird vermittelt, welche Vor- und Nachteile dies mit sich bringt und es werden Optionen aufgezeigt, wie der Kreuzfahrttourismus nachhaltiger gestaltet werden kann.
Zusatzmaterial:
7 Grafiken [PDF]; 8 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF].
Talsperre -wozu?
Durch den Bau von Talsperren versuchen Menschen, die Kräfte der Natur zu bändigen und zu nutzen. Staumauern gehören zu den größten von Menschenhand geschaffenen Bauwerken. TALSPERREN – WOZU? : Der Film gibt u. a. durch Drohnenaufnahmen einen Überblick über die Dimensionen und die vielfältigen Aufgaben eines Stausees: Niedrigwasseraufhöhung; Hochwasserschutz; Energiegewinnung und Tourismus. BAU EINER TALSPERRE: Gezeigt wird, wie schon vor mehr als 100 Jahren ein Großprojekt mit einfachen Hilfsmitteln verwirklicht wird. Die Folgen, die dieses Projekt für die Menschen in diesem Tal hat, werden beschrieben. SCHICKSALSNACHT: Dokumentiert wird, welche Folgen die Zerstörung der Sperrmauer für die Menschen in der unmittelbaren Umgebung hat. Zeitzeugen berichten, wie sie die Schicksalsnacht erlebt haben. PROBLEM LEERER SEE: Verdeutlicht wird ein Interessenskonflikt. Während die Anwohnerinnen und Anwohner durch einen leeren See den Tourismus gefährdet sehen, sind die Regionen unterhalb der Talsperre auf die Wasserabgabe angewiesen, um die Schifffahrt auch in trockenen Sommern zu gewährleisten. Mit sinkendem Wasserspiegel tauchen die Reste der untergegangenen Dörfer wieder auf und locken Menschen an, die sich für die Geschichte des Edersees interessieren.
Zusatzmaterial:
Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF]; Interaktive Arbeitsmaterialien [H5P]; Sprechertext.
Küste und Meer im Wandel
Natürliche und anthropogene Systeme in Wechselbeziehung
Die Lage und Merkmale von Nord- und Ostsee, wie z. B. das Wattenmeer und die Formung der Küste, gehören zum ersten Teil des Lehrfilms. Veränderungen durch die wirtschaftliche Nutzung werden nachfolgend anschaulich dargestellt. Die Bedeutung von Schutzmaßnahmen der Küsten und des Meeres werden im dritten Teil des Films behandelt.
Zusatzmaterial:
Interaktive Aufgaben [H5P]; Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF]; Bilder; Aufgabentexte; Lösungsblätter; Hinweise zur Unterrichtsplanung.
Grundwissen Rohstoffe und Ressourcen: Wasser 2
[Fassung mit interaktivem Lernmodul]
Trinkwasser im Swimmingpool, für die Toilette und zum Autowaschen – diese Szenen leiten über zu der Frage nach unserem Umgang mit dem Rohstoff Wasser. Ein Rundgang durch ein Wasserwerk zeigt, wie aus dem geförderten Grundwasser mithilfe verschiedener Filter sauberes Trinkwasser wird. Verseuchte Oberflächengewässer sowie Verursacher der Wasserverschmutzung verdeutlichen die ständige Gefährdung der Trinkwasserreservoire. In einem Klärwerk wird Abwasser in verschiedenen Anlagen von Feststoffen und wassergefährdenden Schadstoffen gereinigt. Wie im Trinkwasserwerk durchläuft das Abwasser verschiedene Reinigungsstufen.
Grundwissen Rohstoffe und Ressourcen: Wasser 1
[Fassung mit interaktivem Lernmodul]
Die Wasserverteilung auf der Erde wird in einer Animation erläutert. Gezeigt werden die Speicherorte für das lebenswichtige Süßwasser. Auf einer Weltkarte leuchten Länder mit Wasserüberschuss und solche mit Wassermangel auf. Animierte Grafiken, darauf abgestimmte Bilder und die notwendigen Schlüsselwörter verdeutlichen den Wasserkreislauf. Der tägliche Wasserverbrauch pro Person wird erläutert und vertiefend thematisiert mit Bildern aus Landwirtschaft und Industrie. Beispiele mit grenzübergreifenden Flusssystemen weisen auf mögliche Konfliktgebiete hin. Szenen über die Folgen des Wassermangels fordern zum Nachdenken und Handeln auf.
Zukunft Agroforst [Fassung mit interaktivem Lernmodul]
Die industrielle Landwirtschaft stößt an ihre Grenzen. Ausgelaugte Böden, belastete Gewässer, eine verschwundene Artenvielfalt sowie Ertragseinbußen durch den Klimawandel fordern ein Umdenken. Die Perspektive: Bäume auf die Felder. Vier Agroforst-Landwirte berichten, wie sie Bäume und Sträucher gepflanzt und mit Ackerkulturen oder Tierhaltung so kombiniert haben, dass diese sich ergänzen und positiv beeinflussen. Getreide- und Gemüseanbau unter Bäumen, Hühner zwischen Obstbäumen, Mastschweine im Wald: Animationen und Expertenstatements verdeutlichen, dass die Agroforstwirtschaft eine ökologische, klimaresiliente, das Tierwohl respektierende wie auch wirtschaftliche Entwicklung unserer Landwirtschaft ermöglicht.
Heizen mit Holz
Früher lebten die Menschen eher klimaneutral und heizten mit Holz. Doch es stellt sich die Frage, ob Heizen mit Holz wirklich klimaneutral ist. Zunächst wird gezeigt, wie die Pflanzen mit Hilfe der Fotosynthese Kohlenstoffdioxid binden und speichern, das dann bei Verbrennung oder Zersetzung wieder in die Atmosphäre entweicht. Dazu wird die Kritik am Heizen mit Holz aufgegriffen: Die Emission von Schadstoffen, die drohende Übernutzung unserer Wälder sowie die Gefährdung des Waldbodens als Kohlenstoffspeicher. So entwickelt sich Schritt für Schritt auch ein Verständnis für den Kreislauf des Kohlenstoffs und die Einsicht, dass die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen dazu beitragen kann, fossile Energieträger und den in ihnen gebundenen Kohlenstoff zum Schutze unseres Klimas im Boden zu lassen.
Arbeitshilfe [PDF]; – 27 Arbeitsblätter [PDF]; – 27 Arbeitsblätter [Word] – 29 Interaktives Arbeitsmaterial – Internet-Links; – Filmtipps.
Atomkraft ein Auslaufmodell?
Die Kernenergie ist in Deutschland wohl die umstrittenste Art der Energieversorgung. Spätestens nach den Reaktorunfällen in Tschernobyl und Fukushima schienen Atomkraftwerke nicht mehr tragbar zu sein und der beschlossene Atomausstieg im Jahre 2011 läutete das Ende der Kernenergie in Deutschland ein. Nach einem historischen Einstieg verdeutlicht der Film die unterschiedliche weltweite Nutzung der Kernenergie. Im physikalischen Teil wird gezeigt, wie ein Reaktor aufgebaut ist und was in seinem Inneren passiert. Die Vor- und Nachteile der Energiegewinnung durch Kernspaltung werden herausgearbeitet. Am Ende wird eine andere Möglichkeit der Kernenergienutzung kurz vorgestellt: die Kernfusion als Zukunftstechnologie.
Klimaschutz
Klimaschutz ist ein Thema, das uns seit einiger Zeit beinahe jeden Tag in den Medien begegnet. Der Film stellt u. a. das Pariser Klimaabkommen vor und erklärt, mit welchen Maßnahmen die Erderwärmung gestoppt werden soll. Zum Abschluss wird gezeigt, wie wir in unserem Alltag durch kleine Verhaltensänderungen zum Klimaschutz beitragen können.
Zusatzmaterial:
2 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF/Word]; 2 Interaktionen [html/H5P]; 3 Grafiken [jpg]; Sprechertext [PDF/Word].
Folgen des Klimawandels
Die Erwärmung des Klimas führt zu zahlreichen Veränderungen auf der Erde. Extremwetterereignisse nehmen zu, der Meeresspiegel steigt und die Klimazonen verschieben sich. Der Film zeigt, wie sich die Lebensbedingungen, abhängig von der Temperaturerhöhung, für den Menschen in den kommenden Jahrzehnten verschlechtern werden. Außerdem wird die Theorie der Kippelemente vorgestellt.
Zusatzmaterial:
2 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF/Word]; 2 Interaktionen [html/H5P]; 3 Grafiken [jpg]; Sprechertext [PDF/Word].
Ursachen des Klimawandels
Der Film erklärt zunächst den natürlichen Treibhauseffekt und geht dann darauf ein, wie der Mensch die Atmosphäre verändert. Vor allem die Freisetzung von Kohlenstoffdioxid aus fossilen Brennstoffen führt zu einer Erwärmung des Klimas. Außerdem wird gezeigt, wie man nachweisen kann, dass die erhöhten CO2-Werte tatsächlich vom Menschen verursacht wurden.
Zusatzmaterial:
2 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF/Word]; 2 Interaktionen [html/H5P]; 3 Grafiken [jpg]; Sprechertext [PDF/Word].
Was ist Klima
Der Klimawandel beherrscht die Schlagzeilen. Als Einführung in das Thema klärt dieser Titel zunächst einige Grundbegriffe. Außerdem werden die Klimazonen vorgestellt und es wird gezeigt, dass es in der Erdgeschichte schon häufiger Klimaveränderungen gegeben hat. Dies hatte jedoch auch immer Auswirkungen auf Lebensräume und Lebewesen.
Zusatzmaterial:
2 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF/Word]; 3 Interaktionen [html/H5P]; 2 Grafiken [jpg]; Sprechertext [PDF/Word].
Globalisierung I
4 Filme vermitteln die Grundlagen zum Prozess der Globalisierung. Positive und negative Auswirkungen von Globalisierung werden vorgestellt. ? Globalisierung – was ist das? ? Globalisierung von Wirtschaft und Handel ? Chancen und Risiken der Globalisierung ? Beispiele der Globalisierung
Zusatzmaterial:
10 Grafiken [PDF]; 10 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF].
Ökologischer Fußabdruck
Der Film zeigt auf, welche Spuren jede und jeder von uns auf der Erde hinterlässt. Der weltweit ungleiche Ressourcenverbrauch wird thematisiert. Wir verbrauchen durch unseren Lebensstil mehr, als die Flächen der Erde in der Lage sind zu produzieren oder sich entsprechend zu regenerieren. Der „Earth Overshoot Day“ ist der Tag, an dem die Ressourcen für das laufende Jahr verbraucht sind. Dieser lag in den 1970er-Jahren noch im Dezember, heute liegt er im Juli. Es wird verdeutlicht, wie wir in den Bereichen Wohnen, Ernährung, Energieverbrauch, Mobilität, Konsum und Freizeit Flächen beanspruchen und Ressourcen verbrauchen. Beschrieben wird das wissenschaftliche Modell des biologischen Fußabdrucks und veranschaulicht, wie sich die Einheit des globalen Hektars – kurz gha – zusammensetzt. Es wird gezeigt, wie sich der eigene ökologische Fußabdruck berechnen lässt und wo Fußabdruck-Rechner auf seriösen Seiten im Internet zu finden sind. Maßnahmen zur Verkleinerung des biologischen Fußabdrucks decken sich häufig mit denen des Klimaschutzes. Das Medium stellt zur Diskussion, wie jede und jeder dazu beitragen kann, dass Ressourcen geschont und gerechter verteilt werden und sich die Erde regenerieren kann.
Wirtschaftsgeographie III
Fünf Filme vermitteln die Veränderungen und Innovationen in globalen Produktionskonzepten. Filme: Vom Fordismus zum Postfordismus; Cluster – Hotspots der Innovationen? ; Global Player; Tertiärisierung der Wirtschaft; Freihandelszonen.
Zusatzmaterial:
10 Grafiken [PDF]; 10 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF].
CO2-Neutralität erreichen
CO2 ist ein natürlich vorkommendes Gas in der Atmosphäre, das im Rahmen eines Kreislaufs von Lebewesen produziert und in Pflanzen gebunden und wieder in Sauerstoff umgewandelt wird. Durch Verbrennung pflanzlicher und vor allem fossiler Rohstoffe wird dieser Kreislauf gestört und mehr CO2 ausgestoßen als von Pflanzen aufgenommen werden kann. Da CO2 ein Treibhausgas ist, begünstigt dies den Klimawandel. Der Film erklärt den CO2-Kreislauf und zeigt Möglichkeiten auf, diesen zu reduzieren.
Zusatzmaterial:
17 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung; 20 Testaufgaben; 10 Interaktive Aufgaben.
Weitere neu eingestellte Medien finden Sie im ONLINE-KATALOG, indem Sie wahlweise auf „14 Tage_neu“, „30 Tage_neu“ oder „90 Tage_neu“ klicken.